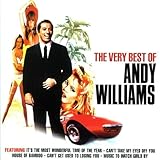Schmerzes Bruder.

"Sie gehen alle von mir – es ist alles wüst und leer – ich bin allein." Georg Büchner.
Viele Menschen richten ihr Leben danach aus, als hätte man Jesus Christus nicht verspottet und gekreuzigt, sondern zum König von Jerusalem erhöht. Ihnen ist nach Bergpredigten, während sie den Karfreitag höchstens zum Anlass nehmen, sich kulinarisch ein wenig zurück zu halten.
Verlassen sein - vom Gottvater, von den Gefährten, von allen anderen sowieso - das ist vielleicht jener Frieden, nach dem unsere Herzen sich so sehr sehnen. Eins sein können mit dem Schmerz und dem Verderben. Die Kraft, sich einer letzten großen Herausforderung zu stellen.
Erlösung kann doch nur sein, wenn jemand uns den Kreuzweg vorausgeht, den wir ins Ewige Leben wählen sollen. Wäre Jesus Christus diesen Weg ein für alle Mal für uns gegangen, wäre unser Dasein so sinnlos wie das eines Knallbonbons. Kurz Lärm machen und dann wieder weg sein, das kann ein Leben nicht sein.
Jesus Christus hat nicht für uns sein Kreuz auf sich genommen, glaube ich, er ist mit uns am Kreuz gestorben. Wenn wir Frieden finden wollen, müssen wir Jesus Christus schon auf seinem Weg nachfolgen.
Als ich begann, mein Menschenalter mit Füßen zu treten, hatte ich Hengstmann 217 Normseiten weit in den Freitod gefügt. Abgetan durch Gift, das ihm zugesteckt worden war von einem Herrenausstatter. Nachdem ich Hengstmann vorsprechen ließ in einem Nachtclub, zwei Gaststätten und bei einer Prostituierten. An die Hand genommen von Ausgeburten sterbensmüder Phantasien. Heiterkeit schrieb ich Hengstmann auf den Leib, während ihm seine Lungenflügel heiser zusammen stürzten.
Ich muss abhusten. Alleine im Zugabteil, reiße ich das Fenster herunter und speie in den Herbstmorgen. Nebel lungert über Weiden und vereinzeltem Nutzvieh. Bereit, jedem aufs Gemüt zu schlagen, der bei Kaffee und Honighörnchen Brüderschaft feiern will mit dem Tag.
Was vom Wort nicht erledigt wird, schafft die Zeit fort. Mutwillig klicke ich mich weiter durch die Textverarbeitung meines Lebens: Absätze einer Gefühlsklitsche, welche auf sich hielt, nicht gespalten zu sein von Sonntagsstaat und Fressbude, sondern versöhnt.
"Die Fahrkarten bitte!" Ein Kontrolleur in Königsblau. Seine Stempelzange hält er wie ein Herz, das er im Fortgang des Lebens lieben gelernt hat. Ich halte gegen mit einem Dokument kleinsten Anspruchs. Quadratzentimeter automatisierten Rechts, dessen Zahlenwerk die Stempelzange ehrt.
Schnalzend beglaubigt die Stempelzange mir den Platz im Leben, den ich augenblicklich einnehme.
"Vorzügliche Verbindung!" lobt der Kontrolleuer meine Wahl.
"Das will niemand wahrnehmen..." ich streiche um die Höhlen, die einmal meine Augen waren.
"Besser als mit dem Frühzug bleibt niemand auf der Strecke!"
Der Kontrolleur weiß um jenen Halt zwischen zwei nach Millionen zählenden Arbeitsstätten. Einen Ort, den kein Business auf der Rechnung hat.
"Nie meine Absicht gewesen, das Geschäft des Lebens zu stören", nicke ich ins leere Rund des Abteils.
Der Kontrolleur lässt seine Stempelzange wippen, als befände die sich in anregendstem Umgange.
"Von den Werktätigen hat sich bisher niemand beschwert, falls ein Streckenbleiber mal nicht den richtigen Anschluss wusste."
Streckenbleiber? Fröhlich blickt der Kontrolleur mir ins Angesicht. Als wüsste er um ein Schattenreich im Schienennetz. Wesenhaftes, das auf den Gleisen währt.
"Kein leichtes Stück. Am Rande wirken Fahrpläne meist nebensächlich." Nun doch neugierig, um was für Verbindungen ein Kontrolleur weiß, dessen Königsblau vieles an Knochengewächsen passieren ließ.
"Nachts auf freier Strecke erscheinen Fahrpläne wie das Gestirn, das, hineingehängt in seine Bahn, unserer Stirn über ist." Der Kontrolleur langt auf solche Weise nach seinem Kopf, als wäre er nicht verwundert, statt seines Hauptes bloß die Luft des Zugabteils zu greifen.
"Sie sprechen Umlaufbahnen an?"
"Mit dem Mond tausche ich manch Nachdenklichkeit aus", nimmt der Kontrolleur wörtlich.
"Würde ich am Strick an einem Baum ebenso Sinn ergeben?"
"Wenn Wind Ihren Leib munter schwingt und Blätter Sie rauschend stimmen..."
Landpartien stelle ich mir vor. Wie man lebenslastig hinaufgrüßt, während ich als überreife Frucht gen Himmel rage, bloß mit Zehenspitzen noch auf Erdengeister weise.
"Stillgeknüpft sein. In flatterndem Fahnenwerk allein meinem Hange dienen..."
"Richtung Nacht verhält es sich gar schwerelos", lässt der Kontrolleur meine Knochen blühen.
Tatsächlich haben Raumteile ihren eigenen Drall, mögen sie selbst jeder Höhe entbehren. Bar aller Physik sehe ich meinen Leib im Nacken des Mondes Purzelbäume schlagen.
Der Kontrolleur nickt, als ich zur Probe im Zugabteil die Arme ausbreite, sie aber sogleich fallen lasse.
"Füttern Sie das Feuer?"
"Keine Angehörigen!" sinne ich nach Entschuldigung.
Die Stempelzange blickt mir auf den Platz, als läge statt meiner eine Urne zur Entsorgung frei.
"Soll ich Werktätigen Meldung machen über ihr Häuflein Asche?"
Ein Regenbogen duftender Jungfrauen stellt sich mir vor. Fruchtig gelacktes Nagelwerk, das Reste meines Odems aus dem Zugabteil lüftet.
"Lassen wir gegelter Arbeitseinheit den Fels Leben, lassen wir schmetterndes Grau unbeascht!"
"Hier wird Kehraus gemacht!" knallt der Kontrolleur seine Hacken. Wahrscheinlich notiert er Schicht für Schicht, mit welch Schräubchen Wort ein geschlagenes Werk Knochen die letzte Umdrehung nimmt, dem Henkershammer leis sich beizugeben.
Wir sehen einander in unsere verbliebenen Gesichter. Der Kontrolleur legt Hand an die Tür des Zugabteils. Seine Hand ist meine Hand. All die Türen, die ich ins Schloss sausen ließ, als das Fleisch noch zum Himmel blühte. Wagenladungen Tod pflügte mein Rücken unter!
Ich zucke mit den Schultern. Eine Geste wie eine Dämmerung. Vernarbte Vorzeit, welche ihre erste Nacht erlitten haben muss als Verheerung. Ohne Schimmer, je wieder das Feuer einer Sonne zu schauen.
Als ich Hand an Türen legte, lebte ich weiter mit dem Schulterzucken Hohläugiger. Weil Leben wenig mehr beherrscht, als fortwährendes Tropfen neuen Lichts in frisch ausgehobene Höhlen.
"Werde ich wohl noch etwas schauen." Ich tue eine Geste Richtung Fenster, das halb geöffnet im Fahrtwind schlottert.
Der Kontrolleur gewährt mir statt des Punktes ein Fragezeichen: "Bestimmt auf allen Vieren!"
In vollem Ernst zieht der Kontrolleur sich zurück. Er lässt die Stempelzange einmal in der Luft schnalzen. Als erfülle er so das Seinige. Ich im Zugabteil wie in einer Kiste Flohmarkt. Ausgenutzt und frei zur Abfuhr. Es ist wohl Fürsorge dabei. Gemeint aber für den Kram, der nicht ausbleibt. Kein Zutun wird mir mehr angesehen. Selbst an Werkbänken wäre ich bloß noch zum Wegwerfen.
Für sich erfüllt jedes Abteil mehr Zweck als ich. Beide wissen wir um abgestellte Kolonnen Fleisch, welche für jedes Polster Sorge tragen. Beide sind wir im Sachzwang. Der Kontrolleur unter seiner Stempelzange, ich auf dem Boden einer Aktiengesellschaft, die den Namen all dessen führt, das um mich herrscht.
"Yup!" grüßt der Kontrolleur. Und so fällt der Übergang vielleicht leichter als jedes geschmierte Stück Psalm.
"Yup!" grüße ich. Mit einer Neigung in Richtung des abwaschbaren Bodens, die mich gewähren lässt. Vor der ins Schloss gefallenen Tür. Vor dem schlotternden Fenster. Vor dem Nebel.
In unserer Klapse ist Xavier Legende. Als ich eingeliefert wurde, war es bereits Jahre her, dass sie, fünf Mann hoch, Xavier auf dem Bahnhofsstrich überwältigten und nach hier verfrachteten.
Der Sage nach, brauchte es Monate, ehe sich seine Träume soweit gebessert hatten, dass man es verantworten konnte, ihn auf uns loszulassen, die wir ganz normal verrückt waren.
Warum ich hier bin, besser gesagt, wieder hier bin?
Anfangs eine kleine traurige Geschichte von einer Goldgrube. Nichts Großartiges. Damit werde ich das, was man mir an Schreibzeug durchgehen lässt, bei Gelegenheit mal behelligen. Und seit der Sache mit Xavier sitze ich hier noch lange genug ein, jeden Fetzen Altpapier der Stadt vollschreiben zu können.
Reden will von den anderen natürlich keiner mit mir: Hey, Lucien, was geht ab! Kannste vergessen. Haben die Hosen voll. Dabei bin ich eher niedlich gewachsen, ziehe Shirts über mit Elchen oder Hasen drauf, und meine Haare wuscheln absichtslos auf dem Kopf herum. Nichts zu machen.
Umgekehrt bin ich während der Therapiesitzungen keine sonderliche Stimmungskanone. Ich meine, die Diplomierten hocken doch alle längst beim Abendbrot, während bei uns mit der Dunkelheit der Spaß richtig losgeht. Nacht für Nacht kommt Xavier mir dumm in meinen Träumen. Ist dann natürlich bloß irgendeine Nase von Pfleger da, der Chemiekeulen schwingt. Nö, bin ich stur.
Xavier schluckte, konnte schlucken. Tabletten und alles im Leben. Hätten die Diplomierten, wie früher seine Freier, genauso in nen Tümpel tun können. Ihre von Chemie gepimpte Hochkultur, und was ihnen an Tiergift so abging.
"Tiergift", kreischte Xavier, während er jede Visage karikierte bis ins Äffische. Seine Weise, mit der er sich hinweghangelte über die menschenfressenden Eichhörnchen, die in seinem Hirn Dienst taten.
Und selbst als er mehr und mehr einem Messer glich, ich habe ihn gemocht. Gemocht habe ich ihn wie jede gottverlassene Bestie aus den Sümpfen.
Wobei es schwer ist, einen Anfang zu finden zwischen Xavier und mir.
Meine Schwäche für Waisenkinder vielleicht. Diese Begeisterung für jedes Stück Leben, über das der Tod hergefallen ist.
Weil es mich nervt, wie Leute herumlärmen, sobald der Tod sie mal zufällig nicht im Auge hat. Einen Grabstein möchte ich denen aufs Maul hauen, ihnen ihr Leben ins Gesicht dreschen.
Umsonst bin ich eben nicht hier.
Im Aufenthaltsraum hatte Xavier seine Ecke. Eine Ecke, die er absonderte von uns durch gefühlte dreihundert Meter Niemandsland: Ob Tisch, ob Stuhl, Xavier trat alles fort, das geeignet schien für den Versuch, sich in seiner Nähe niederzulassen.
Gesellschaft genug schien ihm ein Jo-jo zu sein, das er immer mit sich führte. Teerschwarz hatte er es gefärbt und auf beide Seiten ein bleiches X gepinselt.
Stundenlang saß Xavier auf seinem Schemel im Aufenthaltsraum und ließ das Jo-Jo in die Tiefe schießen.
Manchmal zog Xavier zwischen den Zähnen Luft ein, wenn das Jo-Jo wieder an die Oberfläche rollte. Als habe es aus der Tiefe des Raumes Beute gehoben.
Prüfend blickte er die bleichen Ixe an, die im rasenden Auf- und Abrollen wie schneidender Stacheldraht ausschauten, mit dem Xavier jedem Nichts beikommen konnte.
Mochten die anderen denken, was sie wollten, für mich hatte der Abstand, den Xavier wahrte, etwas Fürsorgliches: Als wolle er niemandem von uns versehentlich das Genick brechen.
Nun war es aber damals so wenig wie heute für mich ein Unglück, das Genick gebrochen zu bekommen.
Zwar tat ich es während der ersten Wochen noch den anderen gleich, glotzte also in sicherem Abstand von Xavier vor mich hin. Aber ich hatte ihr Getuschel, wer oder was Xavier alles sei, bald über: Bestimmt war ich nicht in der Klapse, um mich weiterhin bloß im Fahrtwind anderer etwas zu trauen.
Also ließ ich mir von meiner Mutter, die während jedes Besuches tapfer bei meinem Kosenamen blieb, einen Gummiball mitbringen. Blau wie die Erde von ganz weit weg.
Als würde man Vieh keulen, so ließ der Ball sich hören, als er keinen Meter neben Xavier gegen die Wand schlug.
Xavier und sein Jo-Jo, eben noch im Flüsterton verbunden, schraken zusammen wie ein Liebespärchen tief in den Wäldern.
Daraufhin hörte ich zum ersten Male, welch fabelhafte Stille auf Erden herrschen konnte: Frei selbst von jenen Drohungen, die das Schweigen mit sich bringt, ruhte der Aufenthaltsraum im Abendrot.
Erneut machte ich Miene, den Ball Richtung Xavier zu schmettern. Xavier winkte ab. Lass bleiben! Als hätte er mit einem Seitenblick mein Leben begriffen.
Mit baumelnden Armen betrat ich das Niemandsland zwischen Xavier und mir. Während Xavier mit beiden Händen auf die Knie klatschte, ehe er sich erhob, mich zu ertragen.
"Lucien!" sagte Xavier. Wie jemand, der nach Wendungen einer Sprache fahndete, die vor Ewigkeiten ihren Zweck hatte.
"Du darfst mich gerne töten, falls Dich das beruhigt", lächelte ich.
"Darauf kommen wir zurück!"
Wie zwei Völker standen Xavier und ich uns gegenüber. Beide beherrscht vom Personal dessen, was sich uns eingelebt hatte.
Während ich aber meine Erinnerungen herbei trommelte, mich gegenüber Xavier etwas empfinden zu lassen, das sich anfühlte wie Vertrauen, stand Xavier mit den Seinen scheinbar völlig absichtslos. Als hätte er längst vergessen danach zu fragen, wie zur Hölle sich das alles anfühlte.
"Langweilig so ein Leben!" klang es blechern aus Xaviers Schlund.
"Sollte es spannend sein?" äffte ich Xaviers Art nach, den Kopf beiseite zu neigen.
Er zeigte Zähne: "So bist Du nicht!"
"Du etwa?"
"Schert das wen?"
Zeitgleich zuckten wir mit den Schultern. Was in der Klapse so viel bedeutete, dass wir unsere Brüderschaft beglaubigten.
1.
Hatte der Tropensturm ihn geweckt?
Jay Hector hörte den Wind durch die Zedern und durch die Mahagonibäume fegen. Er hörte Kiefernäste peitschen und er hörte Äste aus Teakholz brechen.
Seit Nächten mussten sie ihre Zelte mit schweren Pflöcken sichern gegen den Sturm.
Aber der Sturm hatte ihn nicht geweckt. Tropenstürme waren üblich in diesem Teil des Urwaldes, den die Eingeborenen "Mosquitia" nannten. Und Jay hatte auf vielen Expeditionen Schlimmeres erlebt. Ein Sturm brachte ihn gewiss nicht um den Schlaf.
Jay tastete nach seinem Revolver. Er nahm die Petroleumlampe und verließ das Zelt: Über der Feuerstelle schimmerte etwas Glut. Über den Zelten aber lag die tiefe Nacht des Urwaldes.
Jay streifte an den Zelten vorbei. Er tauchte jedes kurz in den Schein der Petroleumlampe: Alle verschlossen. Alle, bis auf das größte Zelt! Das Zelt von Mr. Sykes! Jay atmete schneller.
"Mr. Sykes?"
Er leuchtete in die Finsternis des Zeltes. Der Schlafsack von Mr. Sykes war leer!
Jay zog seinen Revolver. Wer ohne schussbereite Waffe in die Augen eines Pumas oder eines Leoparden blickte, der war tot.
Hinter den Zelten hatten sie mit ihren Macheten einen Pfad in den Urwald geschlagen. Dort hatten sie Holz für das Lagerfeuer gesammelt. Lebensgefährlich, den Pfad nachts alleine zu gehen.
Sollte er die anderen wecken? Kopfschüttelnd entschied Jay sich dagegen. Wahrscheinlich war es nichts. Jay stand auf der Payroll vieler abenteuerlustiger Zivilisten. Mr. Sykes aber war bei weitem der Verrückteste. Wahrscheinlich lauerte Mr. Sykes am Ende des Pfades mit dem Bärentöter auf irgendwelche Papageien oder Äffchen.
"Mr. Sykes?"
Meter für Meter pirschte Jay durch den Urwald. Immer wieder ließ er seinen Revolver kreisen. Besonders Kojoten waren tückisch, und hungrig um diese Jahreszeit.
Jay gelangte auf eine Lichtung. Fahles Mondlicht schien auf den Stamm Balsaholz, den sie tagsüber gefällt hatten für das Lagerfeuer. Er leuchtete über den Stamm hinweg: Da hing etwas! Zwischen zwei Zedern.
"Mr. Sykes?"
Hatte dieser exzentrische Cowboy aus Kansas etwa ein Beutetier aufgehängt, jeden Kojoten im Umkreis anzulocken?
Jay hielt den Revolver höher. Keinen Zweig berührte er, als er über den Baumstamm stieg. Vorsichtig näherte Jay sich dem, was da zwischen den Zedern hing.
"Mr. Sykes?"
Er schwang die Petroleumlampe in die Höhe. Das Licht brach sich in den weißen Augen von Mr. Sykes. Kopfüber, den Mund weit geöffnet, baumelte Mr. Sykes zwischen den Kiefern.
Jay wich zurück, stolperte beinahe, stand kurz davor, auf den Leichnam von Mr. Sykes zu schießen.
Viele Spuren hatte er im Laufe seiner Expeditionen gesehen. Nun war Jay Hector auf die des Teufels gestoßen.
2.
Auf dem Flughafen von Tegucigalpa drehten die Frauen sich um nach dem hochgewachsenen, eleganten Mann.
Keine bemerkte das Schulterhalfter, das der Mann verbarg unter seinem maßgeschneiderten Sakko. Keine sah, wie er an den Sicherheitskontrollen vorbeigebeten wurde mit einer Reisetasche, in die er eine Maschinenpistole und Magazine voll Spezialmunition gepackt hatte.
Der Mann hieß Mark Roadman. Er war „Special Operator“ des Außenministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika. Wo immer auf der Welt ein Bürger der Vereinigten Staaten Opfer eines Verbrechens wurde, entsandte das Außenministerium Special Operators, das Verbrechen binnen 48 Stunden aufzuklären.
Nach dem Studium der Psychologie, heuerte Mark an bei der US-Navy. Ausgebildet zum SEAL, nahm Mark teil an Kampfeinsätzen in Afghanistan, in Somalia und im Irak. Er war Träger des Purple Heart und des Silver Star, und er brauchte regelmäßig Schlaftabletten gegen die Alpträume, die ihn heimsuchten.
"Mr. Roadman?"
Ein kräftiger Mann in Uniform trat an Mark heran.
"Der bin ich", sagte Mark und reichte dem Uniformierten die Hand.
"Willkommen in der Hauptstadt von Honduras!" lächelte der Uniformierte. "Ich bin Officer Paolo Zuniga. Während Ihres Aufenthaltes in unserem schönen Land stehe ich Ihnen gerne zur Seite."
Zuniga sprach das Englisch eines Kreolen. Am Ausgang des Flughafens kaufte er Mark für einige Lempira ein kleines Kruzifix.
"Möge es Ihnen eine Hilfe sein", lächelte Zuniga.
Mark war vertraut mit der Verehrung von Jesus Christus, die in Honduras gepflegt wurde. Er bedankte sich herzlich für Zunigas Geschenk.
Fröhlich plaudernd, geleitete Zuniga seinen Gast zu einem Geländewagen der National Police of Honduras.
Es war noch früher Morgen. Auf den Straßen von Tegucigalpa herrschte wenig Verkehr. In einem sportlichen Fahrstil chauffierte Zuniga seinen Gast durch die "Barrios marginales", die Elendsviertel der Hauptstadt.
"Jugendbanden sind hier ein großes Problem!" sagte Zuniga. Er zuckte mit den Schultern. "Wir haben nicht genügend Kräfte, dieser Banden Herr zu werden."
Mark sah erste "Colonias". Stadtteile, welche geschützt wurden von bewaffnetem Wachpersonal.
"Der Bürger ist hier selbst gefordert, für seinen Sicherheit zu sorgen?" fragte Mark.
"Bei Ihnen nennt man das wohl: Wilder Westen!" lachend zeigte Zuniga seine strahlend weißen Zähne.
Sie erreichten den Boulevard Morazan mit seinen Botschaften und Luxusrestaurants.
"An unserem Hochzeitstag waren meine Frau und ich hier Essen", lächelte Zuniga. Sein Daumen und sein Zeigefinger rieben sich aneinander, wie kostspielig dieser Tag gewesen war.
Mit quietschenden Reifen bog Zuniga ab in die Colonia Casamata, dem Sitz des Hauptquartiers der National Police of Honduras. Trotz aller Plauderei wusste er, dass sein Gast keine Zeit zu verlieren hatte. "Sie lösen jeden Fall in 48 Stunden?" wollte Zuniga wissen.
"Nicht immer. In Shanghai hatte ich Probleme mit den örtlichen Behörden. Im Sudan operierte ich mitten im Bürgerkrieg."
"Sie sind selbst ein, wie sagt man, Krieger?" Zuniga schien fasziniert von dem US-Amerikaner, dessen Haar militärisch knapp geschnitten war.
"Ein Verteidiger der Freiheit", wägte Mark ab. "Aber es fühlt sich jede Tat mies an, wenn sie begangen wird mit einem Messer in der Hand."
Zuniga war anzusehen, wie sehr der Tod in Honduras zum Leben gehörte. Wahrscheinlich sah er während eines Bandenkrieges in Tegucigalpa mehr, als viele GIs im Kriegsgebiet. Entsprechend unkompliziert seine Meinung zur Verteidigung der Freiheit mit Waffengewalt: "Wenn nicht wir, wer dann?"
3.
Das Hauptquartier der National Police of Honduras war ein weiß gestrichener Zweckbau. Die Morgensonne schien in hellen Streifen durch das verglaste Portal. Mark und Zuniga wurden sofort in Empfang genommen und zu den Fahrstühlen geleitet.
Im obersten Stockwerk, mit Blick auf die Kathedrale St. Michael, war offenbar extra für den Gast aus den Vereinigten Staaten eine "große Lage" hergerichtet worden. Mehrere altgediente Offiziere in Paradeuniformen erhoben sich, als Mark und Zuniga hereingeführt wurden.
Ein vergrößertes Passbild des ermordeten US-Amerikaners leuchtete bereits auf der Leinwand am Ende des Raumes. Nach unvermeidlichen Begrüßungsworten über die guten Beziehungen zwischen Honduras und den Vereinigten Staaten, konnte Mark gleich zur Sache kommen:
"Fleetwood Sykes, 47 Jahre alt. Inhaber einiger Diner entlang der Highways rund um Kansas City. Zwei Anklagen wegen Verstoßes gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen. Beide eingestellt."
Mark blickte Zuniga an, der aus einer schwarzen Kladde vortrug, was die Behörden in Honduras ermittelt hatten:
"Vor drei Wochen landete Mr. Sykes auf dem Flughafen von Tegucigalpa. Er gab an, in Honduras Urlaub machen zu wollen. Laut der Bilder der Überwachungskameras reiste Mr. Sykes alleine ein. Fünf Tage später wurde er dann aber am Rande der Mosquitia in Begleitung von vier Männern, zwei davon offenbar Einheimische, und einer Frau gesehen. Gestern ging hier via Sattelitentelefon ein Notruf ein. Der Anrufer war männlich und wirkte sehr gefasst, als er den gewaltsamen Tod von Mr. Sykes meldete."
"Das Satellitentelefon ist registriert auf einen Jay Hector", war die Reihe wieder an Mark. "Mr. Hector ist Kanadier. Er trat in Erscheinung als Söldner auf dem Balkan und als Bodyguard. Gegen ihn liegt eine Bewährungsstrafe vor wegen schwerer Verstöße gegen die Einfuhrbestimmungen Kanadas."
"Laut dem georteten Satellitentelefon von Mr. Hector, liegt der Tatort mehrere Tagesreisen tief im Urwald", ergänzte Zuniga. "Es sind bereits entsprechende Einsatzkräfte in Marsch gesetzt worden, mit deren Eintreffen am Tatort aber frühestens übermorgen zu rechnen ist."
Darauf erhob sich einer der Altgedienten in Paradeuniform und zählte auf, was man dem Gast aus den Vereinigten Staaten alles für seine Ermittlungen zur Verfügung stelle. Angefangen von einer Schlafgelegenheit in einem der ersten Hotels von Tegucigalpa, bis hin zu einem eigenen Schreibtisch in dem Lageraum, wo die Funksprüche der Einsatzkräfte eingingen, die sich auf dem Marsch zum Tatort befanden. Selbstverständlich würde man Mark bei Bedarf auch einen Dolmetscher stellen.
Mark bedankte sich höflich für die Umstände, die man sich wegen ihm mache.
"Kennen Sie die Koordinaten des Tatortes?" wollte Mark von dem Altgedienten wissen.
Der warf einen Seitenblick auf Zuniga und nickte.
"Dann erbitte ich von Ihnen nur zwei Dinge", lächelte Mark, "einen Fallschirm für mich und für Mr. Sykes einen Leichensack."
4.
Zwei Stunden später kreiste ein Hubschrauber der National Police of Honduras über der Mosquitia. Von den Stränden Nicaraguas bis weit nach Honduras reichte dieser Urwald. Jagdgebiet zahlreicher Raubtiere, aber auch das Reich geheimnisvoller Ureinwohner wie der Pesch oder der Tawahka Indianer.
Mark dachte an Fleetwood Sykes, diesen Cowboy aus Kansas, den in der Mosquitia vielleicht das Schicksal ereilt hatte, das Fremde häufig ereilte, denen der Respekt fehlte.
"Wegen welcher Vergehen gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen wurde Mr. Sykes angeklagt?" wollte Zuniga wissen.
Zuniga war seit seiner Militärzeit mit dem Fallschirmspringen vertraut, und er hatte darauf bestanden, Mark in die Mosquitia zu begleiten.
"Sykes hatte es sich in den Kopf gesetzt, seinen Loft mit kiloweise Elfenbein zu schmücken. Und er wollte aus zwei japanische Riesensalamandern Boots fertigen lassen." Mark schüttelte den Kopf. "Offenbar um auf Rodeos damit zu protzen."
"Vielleicht meinte er nun, in der Mosquitia Leoparden ans Fell zu müssen." Zuniga nahm sich erneut das Fernglas vor, in dem schier undurchdringlichen Grün vielleicht die Spuren von Sykes Lager zu erspähen. Ergebnislos. Sie flogen über völlig unerschlossenem Gebiet, mit nichts als den Daten eines georteten Satellitentelefones, beinahe zwei Tage alt. Seit dem Notruf war das Telefon ausgeschaltet geblieben. Jedenfalls waren ihnen aus Tegucigalpa keine neuen Daten in den Hubschrauber gefunkt worden.
Zuniga redete auf Spanisch mit dem Piloten des Hubschraubers. "Wenn wir es riskieren wollen, dann jetzt! Der Pilot besteht auf einer Reserve an Treibstoff für seinen Rückflug nach Tegucigalpa."
Ohne ein weiteres Wort schnallte Mark sich den Fallschirm um und begab sich in den hinteren Teil des Hubschraubers, wo der Co-Pilot bereits wartete.
Keine Minute später nickten sich Mark und Zuniga ein letztes Mal zu: "Go!"
5.
Baumkronen schienen auf die beiden Springenden zuzurasen, während sie von der Mittagssonne in gleißendes Licht getaucht wurden. Schon öffnete Zuniga seinen Fallschirm, Mark tat es ihm gleich. Beide wurden sie hoch in den Himmel gerissen, als der Wind brausend in die Fallschirme wehte. Sekunden später sanken Mark und Zuniga einer Gruppe von Baumriesen entgegen. Besonders Zuniga musste gegenlenken, um nicht mit seinem Fallschirm in einem der gewaltigen Äste hängen zu bleiben.
Mark und Zuniga landeten inmitten von mannshohem Buschwerk auf einer Schicht wuchernden Farnkrauts. Rasch warfen sie ihre Fallschirme ab und zeigten einander mit gehobenen Daumen an, dass alles okay war.
Routiniert kämpften beide sich durch das Buschwerk, während über ihnen zahllose Aras sie zu begrüßen schienen. Zwischen armdickem Wurzelwerk erreichten sie Streifen rötlich schimmernder Erde, auf denen Ameisen krabbelten. Dort nutzten Mark und Zuniga einen verwitterten Felsblock, um über ihre Marschroute zu beraten:
"Das GPS zeigt an, dass wir keinen Kilometer entfernt sind von der Stelle, von wo der Notruf abgesetzt wurde", stellte Zuniga fest. Er verwaltete das Material, das ihnen von der National Police of Honduras gestellt wurde. Und es war gewiss nicht seine Schuld, dass in diesem Teil der Mosquitia kein Goldrausch für exakte Landkarten gesorgt hatte. Ein Kompass blieb so ihre einzige Sicherheit, wenn die Technik versagte, was sie nach einigen Nächten im Urwald regelmäßig tat.
"Höchstens eine Stunde Richtung Süden", gab Zuniga mit der Spitze seiner Machete die Richtung vor.
"Jay Hector ist Profi genug, Fallen aufzustellen", schätzte Mark das Umfeld eines möglichen Lagers ab. Jede Expedition stand und fiel mit dem Gewicht der Rucksäcke. Profis jagten vor Ort, statt sich Feldküchen auf den Rücken zu schnallen.
Mark und Zuniga hatten in den Taschen ihrer Tarnanzüge Zwieback und Traubenzucker für zwei Tage. Darüber hinaus mussten sie eben in die Pilze gehen. Wasser würde jedenfalls kein Problem sein. Durch die Regenzeit waren in der Mosquitia aus vielen Bächen reißende Ströme geworden.
"Achten wir also auf Fallgruben und Fangsteine", seufzte Zuniga, "falls Mr. Hector nicht ohnehin aus Bequemlichkeit ein paar Tellereisen mit auf die Reise genommen hat."
Beide hatten sie kaum ihren Marsch begonnen, als Mark plötzlich herumfuhr und angestrengt in Richtung des Gestrüpps spähte, in dem sie ihre Fallschirme zurück gelassen hatten. Ein Schwarm Kolibris stob hinauf zu den Kronen der Baumriesen.
Zuniga legte Mark die Hand auf die Schulter: "Leoparden lauern nachts auf Beute", lächelte er.
Mark nickte: "Leoparden, ja."
6.
Mark und Zuniga schlugen sich durch das Dickicht einer urgewaltigen Vegetation. Grüne Höhlen, die sie zweifeln ließen, ob noch Tag herrschte oder bereits tiefe Nacht. Allesfressende Ameisenkolonien mussten sie überwinden, und verrottete Mückennester, die mit ihrer beider Blut Orgien feiern wollten.
"Kennen Sie die Sierra Parima in Kolumbien?" fragte Zuniga mit zusammengebissenen Zähnen.
Mark ließ seine Machete grimmig durch ein Gewirr Lianen schnittern. "Aus Erzählungen über barbarische Guaharibos, die auf unseren Knochen Flöte spielen."
Zuniga lachte bitter: "Menschen sollen in der Sierra Parima bei lebendigem Leibe verwesen! Habe ich bisher nicht geglaubt. Jetzt schon."
An einer Stromschnelle endlich brachen Mark und Zuniga aus dem Grün hervor. Wasser schöpften sie sich mit ihren Feldflaschen, Wasser!
"Ich hoffe, Sie waren auf der Polizeischule bekannt für Ihre tollkühnen Sprünge", sprach Mark seinen Marschgefährten an.
Beide blickten auf zwei Felsvorsprünge, an deren Unterseiten Getier haftete, und deren Oberseiten glänzten vor Nässe. Fünf, leicht sechs Meter breit schoss schäumend der Strom zwischen diesen steinernen Ufern hindurch.
"Ehe Sie nach dem Weltrekord fragen", Mark verzog keine Miene. "Acht Meter fünfundneunzig."
Zuniga schwieg. Er schien unschlüssig, ob er als Vertreter der National Police of Honduras gegenüber dem Gast aus den Vereinigten Staaten Galgenhumor an den Tag legen konnte.
"Ich springe zuerst!" entschied Zuniga sich für blankes Pflichtbewusstsein.
Jetzt war es an Mark, die Hand auf die Schulter seines Gegenübers zu legen: "Meine Kindheit verbrachte ich auf einer Ranch in Montana. Mit vierzehn empfand ich mich bereits als respektablen Roper. Keine Minute brauchte ich, einen ausbrechenden Stier zu Fall zu bringen." Mark zog ein Lasso aus seinem Rucksack. "Das wird uns helfen!"
Aus der Drehung warf Mark die Schlinge des Lassos nach einem der mächtigen Äste am anderen Ufer. Bereits sein erster Wurf traf. Mark spannte das Rope und schlang das Ende um den Stamm einer Kiefer.
Mit der Übung eines Polizisten in einem der unwegsamsten Länder der Welt, hangelte Zuniga sich über den reißenden Strom.
Angekommen, hob Zuniga lächelnd den Daumen.
Mark löste das Ende des Lassos, nahm Anlauf und schwang routiniert hinüber an die Seite Zunigas.
"In welche Richtung?" Mark folgte Zuniga über den Rand der Böschung, während er sein Lasso zusammen wickelte.
"Keine hundert Meter..." weiter kam Zuniga nicht. Als der Sandboden der Böschung unter ihnen nachgab, dachte Mark an Ameisenlöwen, die geduldig in Sandtrichtern auf Beute lauerten.
Sie waren in eine Falle geraten!
„Elefantenfrau!“
Vor ihren Freundinnen ruft Morgaine mich immer so. Ich will das verbuchen als die Unreife eines Mädchens, dessen einzige Zukunft es ist, das Hotelimperium ihrer Eltern zu erben.
„Serviere uns Champagner!“
Kichernd heben Morgaines Freundinnen die Tulpengläser. Morgaine aber ruft sie zur Ordnung:
„Hinstellen!“ grinst sie. „Wir wollen doch wissen, ob die Elefantenfrau alles richtig macht.“
Seit vier Tagen lässt Morgaine ihre Volljährigkeit bereits feiern. Mit jedem Tag wächst ihre Lust am Herrschen. Gestern feuerte sie einen Oberkellner. Weil der nicht freundlich und warmherzig genug reagierte, als sie ihm einen Teller Garnelen und Trüffel wie ein Frisbee vor die Füße schleuderte.
Nun schauen diese Herrinnen der Tafelrunde auf mich!
Eine Doppelmagnum, drei Liter. Ich wuchte die Flasche hoch. Dabei halte ich meinen Körper so nach vorne geneigt, wie Morgaine es ihrem Personal vorschreibt.
Daumen am Korken. Den Draht um den Korken löse ich, als würde ich eine Bombe entschärfen. Während an der Festtafel alle darauf lauern, dass mir die Doppelmagnum explodiert.
Das Flaschenglas ist schmerzhaft kalt. Ich hätte ein Geschirrtuch nehmen sollen. Aber Morgaine empfindet alles, was mit Küche zu tun hat, als unästhetisch. Meine rechte Hand krallt sich fest an der rutschigen Fläche, während ich mit der anderen am Draht fingere.
Atmen! ermahne ich mich dabei immer wieder.
Als ich den Drahtkorb des Korkens in der Hand halte, zieht Morgaine einen Strohhalm aus ihrem Cocktail: "Wer das Häubchen der Elefantenfrau trifft, kriegt einen Preis!"
Lachend rollen die Herrinnen der Tafelrunde Munition aus dem Aluminiumpapier, mit dem das Fingerfood frisch gehalten wurde.
"Was gibt es da zu glotzen, Elefantenfrau!"
Nicht zittern! Reißt mir die goldene Folie um den Korken, hat Morgaine einen weiteren Grund, mir übel mitzuspielen.
Als ich die Folie vorsichtig in einem Stück entferne, schießt mir das erste Aluminiumkügelchen an die Wange. Noch eines! Diesmal an meine Stirn.
"So ein Geschwulst von einem Kopf, und wieder daneben!" Morgaine klatscht den Strohhalm auf den Tisch, nimmt sich einen neuen.
Ich bin erleichtert: Wenn alle mit zielen beschäftigt sind, schaut niemand mir auf die Hände!
Am liebsten würde ich den Hals der Champagnerflasche auf mich richten. Damit der Korken keine der Herrinnen auch bloß entfernt treffen könnte. Kaum Luft bekomme ich bei dem Gedanken, dass Morgaine mich in Haftung nimmt. Für jeden Spritzer Champagner an den Seidentapeten der Lounge oder auf den Perserteppichen.
Mittlerweile schießen die Aluminiumkügelchen von überallher.
"Lässt Du sie eine Clownsperücke tragen?" hebt Gelächter an, als sich Kügelchen in meinen Haaren verfangen.
Der Gedanke an den „dummen August“ im Zirkus hat mich als Kind getröstet: Den lassen sie auch nicht die ganze Vorstellung über in der Manege! Eine Frage der Zeit also, bis die Festgesellschaft die Lust an mir verliert.
Ein dummer August weint nicht! nahm ich mich während meiner Kindheit immer wieder in die Pflicht. So wie ich ausschaue ist es eben unvermeidlich, dass immer mal wieder Menschen sich gegen mich zusammentun.
Ob im Kindergarten oder in der Schule: Als Clownsfigur, die aushält, konnte ich mir manches an Respekt erwerben, glaube ich. Mein Stolz war jeder Kummer, den ich Mutter ersparte.
"Treffer!" kreischt es an der Festtafel, als ein Aluminiumkügelchen mir endlich ans Häubchen klatscht.
"Einen Tag gehört die Elefantenfrau Dir!" lacht Morgaine.
"Die trittst Du ab? Das ist doch kein Preis!"
Allgemeine Empörung.
Beinahe würge ich den Hals der Champagnerflasche, beinahe will ich in Scherben greifen!
„Du hast doch Pferde. Lass sie Deine Ställe ausmisten!“ geht Morgaine die Gewinnerin an, hörbar zerknirscht.
„Muss ich erst Papa fragen.“
Ich balle die Faust um den Korken! Immer verkrampfe ich mich, wenn ein Mädchen von seinem Vater spricht.
„Habe ich was von Pause gesagt?“ brüllt Morgaine mich an.
Ich richte den Flaschenhals auf mein Kinn. Im Augenwinkel sehe ich Morgaines Hand zucken. Aber die Gaudi, die sie wittert, ist ihr dann offenbar mehr wert, als mich wegen meiner Haltung zu schelten. Sie lehnt sich zurück. Auch die anderen Herrinnen der Tafelrunde schweigen. Vergessen ist ihre kleine Misshelligkeit. Es wird sich schon ein Stall finden, wo ich Morgaines Schuld abarbeiten darf.
Meine Kopfadern schwellen mir, als ich die Doppelmagnum in eine Richtung drehe, während ich den Korken in die entgegengesetzte presse. Nichts rührt sich. Schweiß bricht mir aus. Kein Zentimeter!
Ein ergebener Blick zu Morgaine.
Die winkt ärgerlich ihr Einverständnis. Trampel!
Ich hocke mich auf den Boden, nehme die Flasche zwischen beide Knie.
„Wie ein Hündchen, ein Elefantenhündchen!“ lachen die Herrinnen.
Jetzt! Der Korken löst sich, während mir jeden Augenblick eine Ader zu platzen scheint. Ich bin ganz Werkzeug, kämpfe! Mach Mutter keinen Kummer, keucht alles in mir.
Mit einem höhnischen Ploppen löst sich der Korken.
Ich presse die Öffnung an meine Brust. Voller Panik, dass meine Uniform das Überschäumende nicht aufsaugen kann, dass tatsächlich etwas auf die Perserteppiche sprudelt.
Ich habe Glück. Außer einem tiefnassen Schandfleck auf meiner Brust ist weiter nichts passiert.
„Den vergossenen Champagner ziehe ich Dir vom Lohn ab“, fällt Morgaine ein abschließendes Urteil, „und Deine Uniform lässt Du auf Deine Kosten reinigen.“
„Jawohl, Mylady!“
Erleichtert gönne ich dem Mädchen seinen Spaß, sich vom Personal so unverschämt erhöhen zu lassen. Eigentlich muss ich „Mylady“ dankbar sein, dass ich Elefantenfrau ihr dienen darf. Als Zimmermädchen habe ich mich um dutzende Anstellungen beworben - sobald ich ein Foto von mir beifügte, verschwendete kein Arbeitgeber mehr Worte an mich. Die anderen, denen ich kein Foto geschickt hatte, glaubten dann bei der persönlichen Vorstellung an einen schlechten Scherz. Teilweise wurde man richtig wütend, was mir einfiele?
In gebeugter Haltung trage ich die Doppelmagnum vorbei an Morgaines Geburtstagsbuffet: Hünchenbrust-Saté, Involtini von der Pute, Pilze mit Rosmarinsauce, Atlantiklachs mit Zitronengremolata… Angerichtet durch den Küchenchef der Eltern, einem weltweit bekannten Sternekoch. Kaum angerührt. Gelangweilt geknabbert und zerbröselt.
„Bekommen wir den Champagner heute noch?“ Die Jüngste der Runde. Die, die mich für einen Tag gewonnen hat.
Meine Dienstuniform ist derart eng geschnitten, dass ich bloß trippeln kann. Außerdem sind mir Holzschuhe anbefohlen. Halb wohl zur Belustigung, halb, damit ich Morgaine in ihren Gemächern nicht unerwartet störe. Stolpere ich so zur Tür hinein, schaut jeder Gast mich an, als hätte er eine Erscheinung. Morgaine hat dann die Lacher auf ihrer Seite: Was für ein Wohnaccessoire!
Ich spüre jeden Muskel in meinen Unterarmen, als ich die drei Liter Champagner ansetze. Den Herrinnen perlenden Armand de Brignac vollendet einzuschenken. Dabei darf ich die Tulpengläser keinen Zentimeter verschieben. Sonst riskiere ich einen Schlag auf die Finger mit dem „Lathi“. Dieser Schlagstock aus den ehemaligen Kolonien ist eines der vielen Geschenke von Morgaines Eltern zur Volljährigkeit ihres einzigen Kindes.
Damit sie das Herrschen lernt! bestimmte der Vater ihr in seiner Ansprache launig den Weg. Während wir vom Personal dazu in Dreierreihen stramm standen.
"Woher hast Du die Elefantenfrau eigentlich?" will die Jüngste in der Runde von Morgaine wissen.
"Ich bin dem Gelächter nach!"
Da merkt die ganze Runde auf. Mir fließt das Blut tiefrot ins Gesicht. Wodurch meine Haut bloß noch unreiner wirkt als ohnehin schon. Feist lässt Morgaine sich zurückfallen in die Samtpolster ihres thronartigen Sessels.
"Wohlan!" Abschätzig blickt sie zu mir, wann ich endlich alle bedient habe mit Champagner.
Beim Einschenken sehen mich einige scheel von der Seite an, was es mit mir Elefantenfrau wohl auf sich hat!
"Stell die Flasche ab und komm her", zitiert Morgaine mich an ihre Seite.
Sie greift einen Zipfel meines Hemdarmes, als wolle sie allen den Eigentum beweisen, den sie an mir hat.
"Die Elefantenfrau ist uns mit der Frühjahreskollektion zugelaufen!"
"Seit Monaten hast Du die schon?" An der Tafel ringen sie gekünstelt nach Luft.
Morgaine zuckt mit den Schultern: "Ich bin ihrer noch nicht überdrüssig geworden."
"Hast Du die beim Shoppen von der Straße aufgelesen?"
Jetzt ist Morgaine aber beleidigt! Ich kann ihr das nicht verdenken. Seit sie mich in Dienst genommen hat, habe ich sie kein einziges Mal über den Bürgersteig flanieren sehen. Da wartete am roten Teppich immer eine Limousine auf sie.
"Die Tür meiner Suite stand auf. Models und Kleiderständer wurden hereingeschafft, mir neueste Mode vorzuführen. Da hörte ich das Personal am Ende des Flures lachen."
Beim Gedanken an lachendes Personal werden Morgaines Augen zu Schlitzen.
"Ich also raus..."
"...dem Gesinde Beine machen!" die Jüngste blickt Morgaine bewundernd an.
Morgaine nickt huldvoll: "Zwei Kreolinnen mit Servierwagen. Wie festgetackert, als ich mich vor denen aufbaue!"
Die jungen Herrinnen zeigen Zähne. Einige zucken mit den Händen, als hielten sie Peitschen.
„Beide nennen mich artig Mylady, knicksen, vergessen vor Angst das Atmen, japsen also, dass man sich beleidigt fühlen würde.“
Morgaine imitiert das Lachen der Kreolinnen, schüttelt dann die Hand vorm Gesicht, wie Menschen ihren Schmerz ausdrücken können, indem sie lachen.
„Ich pinne der einen meinen Zeigefinger auf die Stirn: Ihr lügt doch! Sie knickst erneut, nennt mich dreimal Mylady und schwört, dass das ganze Flurpersonal beleidigt sei.“
„Wegen der Elefantenfrau?“ Die Jüngste kann es nicht mehr abwarten.
Morgaines Hand gebietet der Kleinen Einhalt: Ich erzähle!
Nach einer Kunstpause, in der Morgaine tut, als müsse sie die Geschichte wieder zusammen bekommen: „Beichtet mir! befehle ich. Und die beide, Ihr könnt Euch das nicht vorstellen, waschen augenblicklich alles an schmutziger Wäsche vor mir, was ihnen in der Angelegenheit auch bloß irgendwie zu Ohren gekommen ist, alles!“
Wie kriecherisch! Die jungen Herrinnen verziehen die Gesichter.
„Also, da säße gerade eine beim Chef, da wollte der die Tür gar nicht zumachen. Man habe ins Zimmer hinein gespitzt und sei jetzt allgemein empört, dass solch… Person überhaupt zur Vorstellung eingeladen werde. Man würde etwas auf sich halten!“
Allgemeines Gepruste über die beiden Kreolinnen, die etwas auf sich halten.
„Die Person wolltest Du natürlich sofort sehen!“
„Mit erhobenem Zeigefinger lasse ich die beiden links liegen und bin sofort zum Personalchef.“ Morgaine schüttelt meinen Arm wie den einer Marionette. „Dort, auf dem Flur, ausgeeselt und heimgeschickt, lief sie mir dann zu…“
„Voll alt, ey!“ Die Jüngste wird mir gegenüber immer kecker. Ich kann es ihr nicht verdenken. Vielleicht ist das Herrin sein solch ein schweres Amt, dass es der Dressur zur Rotzgöre bedarf.
Morgaine blickt an mir hoch, an mir tumben, unförmigen Weibsbild: „23!“
Seltsam, für den Augenblick weiß an der Tafel keiner mehr etwas zu lästern. Vielleicht, weil man bei manchem Elend irgendwann einfach nicht mehr weiß, wie noch weiter hineintreten?
Morgaine als Tischherrin unternimmt einen letzten Versuch, die ausgelassene Stimmung zu retten: „Hab mal gesehen, wie Mutti sie am Personaleingang abgeholt hat. So eine Trutsche! Der hat unsere Elefantenfrau fröhlich was von der Arbeit erzählt, als käme sie gerade aus Paris.“
Die Jüngste kichert nervös. Alle anderen nippen still an ihren Champagnertulpen.
Morgaine wird ungehalten. Kann ich etwas dafür, dass die Stimmung gekippt ist?
„Wie ich diese Menschen verachte!“ knurrt sie in sich hinein. „Tragen und ertragen alles, weil man sie nicht mehr als töten kann!“
Für Augenblicke wirkt es, als wolle Morgaine mich an den Haaren reißen und mir ins Angesicht spucken.
Plötzlich wird es finster vor der Loge. Durch die schallgeschützte Glaswand Richtung Arena klingt leise Jubelgeschrei.
„Das Konzert geht los!“ Alle an der Tafel atmen auf. Schweigend begeben die Herrinnen sich in Richtung des Balkons der Loge.
Morgaine wischt mutwillig ihre Champagnertulpe vom Tisch. „Kehr das fort!“
Ich bleibe zurück mit Besen und Schaufel.
Wieder hat es niemand geschafft, mich vom rechten Weg abzubringen!
Morgaine öffnet die Tür zum Balkon. Selbst am hinteren Ende der Loge ist mir, als knalle das Leben aus tausenden Münder zu uns herein. Augenblicklich jubeln die jungen Herrinnen mit.
Auf Knien spähe ich zu dem Fernseher, der mir gegenüber an der Wand hängt. Dort schwenkt das Bild gerade durch das Rund der Arena.
Ausgehend von einem riesiger Videowürfel unterhalb des Arenendachs scheint alles zu beben im blitzenden Scheinwerferlicht. Dazu donnerndes Wummern aus Batterien von Lautsprecherboxen und Verstärkern. An die Stahlträgern gehängt wie schwarze Bienenstöcke.
"Tiger ist so süß!" ruft die Jüngste. Sie scheint halb irre vor Freude auf diesen Tiger.
Morgaine lacht: "Wie weit bist Du mit Deinem Isländisch?"
"Hyrrokkin talar habe ich mir zuletzt übersetzt. Davor Gylfaginning Sannleikurinn er und Brynhild elskar." Die Jüngste klingt trotzig.
Sie würde wohl meinen, sie habe im Internet nach den Übersetzungen der Hits der Gottesfurcht gesucht! stimmen die anderen ein in Morgaines Spott.
Natürlich habe ich von dieser Band „Gottesfurcht“ gehört! Deren Balladen scheint Morgaine allen Hotels ihrer Eltern als Fahrstuhlmusik zu verordnen.
Neulich mit Mutter im Eiscafé hörte ich gar auf den Toiletten isländisch!
Mag sein, dass mir die Musik gefällt, sehr sogar. Aber ich verbiete sie mir. Ich verbiete mir alle Musik!
Später vielleicht. Wenn ich das Geld zusammen habe für Mutters Operation. Wenn Luft ist für das Abitur oder für eine Lehre.
Die jungen Herrinnen sind in ihrer Vorfreude angelangt bei Betrachtungen über "Subwoofer", welche ihrer Musikanlagen den "fettesten" Bass hat, als ich fertig werde mit den Scherben von Morgaines Champagnertulpe.
Alle drehen mir den Rücken zu. Ich bin also frei in meinen Blicken.
Morgaine hat es nicht gerne, wenn ich ihre Gäste anschaue. Ihnen in die Augen zu sehen verbietet sie mir strikt.
Während ich zerpickten Ziegenkäse mit Honigglasur und Zitronen-Zander entsorge, wage ich mich einige Blick weit heran an die Rückseite eines Lebens als Herrin:
Wie Römerinnen tragen alle ihre mit Seidenblüten bestickten Sandaletten bis hoch an die Fesseln gebunden. Die Jüngste trägt eine vergoldete Glitzerrobe. Morgaine eine türkisfarbene Tunika, die bestickt ist mit weißen Perlen. Weiß scheint bestimmend im Leben der jungen Herrinnen. Weiße Seidentücher über mintfarbene Abendroben, weiße Schleifen und Strähnen, Weißgold!
Weiß geschmückte Schaufenster, an denen ich mir die Nase plattdrücke.
"Es geht los!" klingt es vom Balkon der Loge wie aus einem Mund.
Schlagartig liegt die Arena in vollkommener Nacht. Das Publikum kreischt vor Aufregung. Erlebnishungrige, denen die Dunkelheit das Gitter fortreißt.
Fanfaren. Aus Hörnern, welche sich in der Ferne verlieren. Die Fanfaren werden zum Rhythmus.
Ich wehre mich gegen meinen Herzschlag. So gut es eben geht, räume und putze ich selbst im Dunkeln weiter. Klare Anweisung Morgaines. Immer wenn sie mich sieht, will sie mich in Bewegung sehen!
Offenbar ist der Rhythmus bekannt. Im Publikum erhebt sich so etwas wie Triumphgesang. Auch die jungen Herrinnen grölen mit. Als wären sie aufgezogen von etwas, großer als ihr Herrinnensein.
Dann, scheinbar weit über der finsteren Arena, irgendwo in den Sternen: "Gottesfurcht!"
Die Jüngste kreischt auf. Es hört sich an, als müsse sie gestützt werden.
Eine Stimme hebt an. Scheinbar ein Refrain, ein Mantra.
"Tiger!"
Ich höre Morgaine, wie sie beruhigend einredet auf die Jüngste.
Erschrocken merke ich, dass ich still stehe, dass ich weder putze noch Ordnung schaffe.
Die Stimme… wie Glockenklang, der über den Feldern nachhallt. Sie singt nicht, sie betet!
Die Stimme verstummt. Es bleibt finster in der Arena. Pfiffe, Verzweiflung. Ich kann mich wieder rühren.
Streichmusik. Leise erst, dann lauter, stürmischer. Dort, wo die Bühne sein muss leuchtet, ja, flammt etwas auf. Ich schaue zum Fernseher: Zwei gewaltige Leinwänden an den Seiten der Bühne. Ödes Land zeigen sie, in Lava und Asche versunken.
Über die Streicher ziehen Trompeten her, als aus der Lava ein Wikingerschiff in See sticht. Die Kamera hebt ab vom Schiff. Ich erkenne die Felsen von Stonehenge. Um die Felsen herum Wikinger. In wehenden Umhängen, mit Streitäxten und glänzenden Schilden.
Stille herrscht in der Arena, als diese majestätischen Gestalten ihre Blicke hoch zum Himmel richten.
Wieder hebt die Kamera ab. Sie weht hinweg über tiefstes Mittelalter. Westminster Abbey! Eine Königskrone auf dem Altar. Die Kamera streicht über das Haupt eines einzelnen Mannes. Wie er Andacht hält vor der Krone. Richard Löwenherz?
Geschichte war nie mein Fach. Mich hat stets die Mathematik getröstet.
Erneut ist die Kamera mit Schiffen. Fahnen und Segel, bemalt mit den Symbolen des Glaubens an den Erlöser Jesus Christus.
Wir rasen über das Meer, hinein in fruchtbares Land, rasen über Stadtmauern auf die Zinnen eines prachtvollen, eines mächtigen Gebäudes.
"Der Tempel von Jerusalem!" höre ich aus dem Dunkel des Logenbalkons.
Beinahe fühle ich mich mit einer Ohrfeige aus dem Film geschlagen: Darf ich ungetauft als "Heide" eigentlich auf einem Friedhof liegen?
Benommen sehe ich, wie die Kamera weiterfliegt. Halbmonde und Minarette sehe ich. Das ist die Hagia Sophia! Von der habe ich gelesen in einem Buch über die Sternstunden der Menschheit.
Aber mein Wissen kommt nicht bei mir an...
Diese jungen Herrinnen auf dem Logenbalkon, sie mögen sich eins fühlen mit Konstantinopel und dem römischen Reich. Beinahe glaube ich sie atmen zu hören, als der Petersplatz gezeigt wird, die Alpen, der Sturm auf die Bastille, Neuschwanstein. Die jungen Herrinnen scheinen so selbstverständlich so eins mit der Welt wie nur irgendwas.
Deutschland. Binnen weniger Augenblicke ersteht es auf aus Ruinen. Im Publikum jubeln einige beim Anblick bestimmter Bauwerke, andere lachen oder pfeifen. Die Kamera schwenkt Richtung Meer.
Am Strand, auf Höhe des Marine-Ehrenmahles, verfliegt das Streichorchester. Windböen sind zu hören, als die Kamera über dem Ehrenmahl kreist. Sie nähert sich der Plattform, fast hundert Meter über dem Meer: Fünf Männer werden größer und größer. Einer am Schlagzeug, einer am Horn. Zwei Gitarristen. Der Sänger. Die „Gottesfurcht“. Schweigend und stolz.
Das Auge der Kamera gleitet zu auf die Sonnenbrille des Sängers. Bis die Brillengläser die beiden gewaltigen Leinwände beherrschen. Bis das Auge der Kamera versinkt in ihnen wie in einem schwarzen Meer.
Erneut wird es Dunkel. Meeresrauschen klingt nach. Stille. Kein Laut aus Zehntausend Mündern.
Ich knülle ein Putztuch in meinen Händen. Auf die Lippen beiße ich mir, warum ich so nutzlos herumstehe!
Ich taste nach der Küchenzeile der Lounge. Mich wenigstens an meinem Platz zu befinden, ehe Morgaine...
Das Licht explodiert! Auf dem Balkon kreischen die Herrinnen im Angesicht der Welle elektrischen Blaus, welche durch das Arenenrund brandet.
Ich lasse mein Putztuch fallen. Nein, ich werfe es fort! Welch eine Bühne, die dort aus Blitzen aufersteht!
Ein Kirchenschiff. Zwanzig Gebetsbänke weit zum Altar. Choremporen. Stuck und Marmor. Kronleuchter. Stützpfeiler, mit Putten verziert. In der Mitte der Bühne eine gewaltige astronomische Uhr. Am himmelblauen Rand geschmückt mit Skeletten.
Selbst aus der Totale des Fernsehers sehe ich, wie im Publikum zahlreiche Münder offen bleiben.
„Mortal er allt“, donnert es aus den Lautsprechern.
„Sterblich ist alles“, jubelt die Jüngste. Offenbar ein weiterer Welthit der Gottesfurcht.
Orgelmusik tönt durch das Arenenrund. Lichtspots fegen über den Kirchenboden. Tausende kreischen auf, als an den Bühnenrändern vier hohe Kirchenfenster bersten.
Das mit Raben bemalte Buntglas klirrt durch hundert Verstärker. Ihm nach springen vier Gestalten. Kriegshelme, Kettenhemden, Schuhwerk mit Eisennägeln. Sie greifen nach den Instrumenten, die auf den Gebetsbänken liegen: Eine Marschtrommel, ein Schlachtenhorn, zwei Gitarren. Das Publikum tobt.
Beinahe lasse ich mich in den Sessel von Morgaine fallen. Als wäre ich in der Musik der Gottesfurcht zuhause. Als gäbe die Musik mir das Recht dazu.
Im Gleichschritt marschieren alle vier an den Bühnenrand.
Die spielen ihre Instrumente nicht, die lieben sie! Als würden vor ihnen nicht Tausenden mit den Füßen stampfen.
Während einer Großaufnahme erkenne ich es: Den Blick wachsam auf ihren Instrumenten, flüstern alle vor sich hin. Lässt Perfektion sich beschwören?
„Wo bleibt Tiger?“
Die Jüngste lässt mich zurück zucken vom Fernseher. Was treibe ich hier eigentlich? Ein Dienstmädchen, das von allen Elefantenfrau geschimpft wird. Auf der Hut muss ich sein, immer, wenn ich überleben will. Und darum geht es doch wohl, ums Überleben.
„Tiger!“ schreit die Jüngste.
Keine der Herrinnen wirkt, als würde je eine wieder hinter sich schauen.
Immer noch stehe ich am Fernseher herum. Ohrfeigen möchte ich mich dafür. Aber die Musik lässt mich nicht.
Wenigstens ist noch genug Würde in mir, mein tumbes Fleisch nicht den Gitarrenriffs der Gottesfurcht zu überlassen. Selbst im Traum habe ich mich niemals tanzen sehen!
„Tiger! Tiger! Tiger!“ Mit einer Stimme verlangen Tausende nach ihm. Während die vier Gottesfürchtigen am Rande der Bühne wie aus einer anderen Welt spielen.
Selbst als das Skandieren zum Geschrei wird! Mehrere Mädchen fallen wie leinene Bündel vom Kronenleuchter, welcher an der höchsten Stelle der Bühnenkonstruktion montiert ist. Fünf Meter, zehn Meter, fünfzehn. Einige in der Arena reißen die Hände vor den Mund.
Nichts hält das Publikum mehr auf den Sitzen, als die Mädchen, vielleicht keine zwei Meter vor dem Aufprall, mit Macht hochgerissen werden. Gesichert offenbar durch Bungeeseile.
Die Mädchen lachen, ihre Haare wehen. Zwölf an der Zahl, breiten sie in den Lüften ihre Arme aus. Artistinnen sind das!
Die zwölf formieren sich. In vollendeter Choreographie kreisen sie um den Kronenleuchter. Als würden sie eine Sonne preisen.
Das mächtige Ornament hoch über dem Altar, es ist nicht an die Wand gemalt! Fasziniert berühre ich es auf dem Fernseher. Wie es mit einem Male trübe wird und verschwimmt. Eine Projektion war das, irgendwo aus dem Dunkel der Arena.
Stattdessen ist da jetzt der Sänger mit der Sonnenbrille als Trickfigur. Sturm fegt ihm durch den Umhang. Wie ein Freibeuter an einem Seil schwingt die Trickfigur auf das Publikum zu. Gewaltig plötzlich die Sohlen seiner Militärstiefel. Das Glas über dem Altar zerspringt in einen funkelnden Scherbenregen.
„Tiger Larsen!“ begrüßen die vier Gottesfürchtigen vom Rand der Bühne ihren Sänger.
Die Jüngste applaudiert Sturm. Morgaines Arme schießen hoch. Als wolle sie fortgerissen werden.
Tiger schwingt über der Bühne. In einer Hand das Mikrofon: „Idise losa stríðsmaður!“
Der Tierkreis der astronomischen Uhr feuert Lichtbilder in die tobende Menge. „Rope yfir hylinn!“
„Seil über dem Abgrund“, singen die Herrinnen mit.
Dieser Mann heiligt den Boden! Keine Treppenstufe habe ich je so selbstverständlich genommen, wie Tiger eine Höhe von dreißig, vierzig Metern.
Als er seinen Umhang ins Publikum wirft, will ich eher an den Klapperstorch glauben, als an die Wehen der Geburt. Tiger muss durch die Hand eines Gottes gegangen sein!
Während der Pubertät habe ich mich nach der Schule in Museen versteckt, weil ich es mit meinem Körper nirgendwo anders aushielt. Keines von den Meisterwerken dort, welche mir halfen, trotz allem an die Welt zu glauben, war auch bloß annähernd so wundervoll wie seine Statur...
Mein Schädel fliegt zur Seite. Beinahe schlage ich gegen die Wand. Solche Wucht hat die Ohrfeige.
„Träumst Du?“ Morgaine ist außer sich.
Die Erdbeertarte! So bald Tiger erscheint, sollte ich sie den Herrinnen mit Kerzen und Feuerwerk servieren. Das war Morgaine für den Ablauf ihrer Geburtstagsfeier derart wichtig, dass sie mich diese Anweisung zweimal hat wiederholen lassen, ob ich sie auch wirklich verstanden habe.
„Entschuldigen Sie, Mylady. Bitte entschuldigen Sie!“
„Schlag das Vieh tot!“ grinst die Jüngste. Ihre Augen sind leer vor Eifersucht. Auf die Artistinnen, auf alle Mädchen, welche Tiger von der Bühne aus ansieht.
„Kriegt Ihr das geregelt?“ Die anderen Herrinnen winken vom Balkon aus. Das Konzert!
Vor Haß findet Morgaine keine Worte.
„Fünf Minuten, sonst schmeißt Deine Herrin Dich nutzloses Stück vom Balkon!“ Die Jüngste zieht Morgaine mit sich.
Ich fliege zur Küchenzeile. Mit zusammen gebissenen Zähnen fingere ich sanft mehrere Lagen Schutzfolie von der Tarte. Eine Hand halte ich mir mit der andern fest, mein Zittern in den Griff zu bekommen.
Wo ich die Kerzen hineinstecke und wo das Feuerwerk, davon habe ich geträumt! Der Plan des Konditors hat sich mir eingebrannt, als wäre er Sinn und Zweck meines Lebens.
Nur zwei Streichhölzer! Ich hätte Morgaine bitten sollen, eine Packung mitbringen zu dürfen. Selbst als sie mir wütend abwinkte. Meine Uniform hat keine Taschen. Ich muss Mylady Rechenschaft geben über alles, was ich an mich nehme.
Zwei Streichhölzer für achzehn Kerzen, und für das Feuerwerk! Ich hätte siebzehn hineinstecken sollen, um mit der achzehnten alle zu entzünden. Hätte. Nun würde ich mit solch einer Aktion die Glasur riskieren.
Kopflos bin ich gewesen nach Morgaines Ohrfeige, kopflos! Dafür könnte ich mir selbst eine reinhauen.
Zwei Streichhölzer, und keine drei Minuten mehr übrig von den fünf, welche mir durch die Jüngste als Gnadenfrist gesetzt sind.
Dem Himmel sei Dank habe ich trainiert! Seit die Tarte auf dem Speiseplan der Loge steht. Holz vom Körper weg gegen die Reibefläche streichen. Bis das Holz zwischen meinen Wurstfingern weder bricht noch fehlzündet.
Mutter war fassungslos, als sie all die leeren Streichholzschachteln sah. Aber das kann ich jetzt. Dafür wird Morgaine mir keine langen können!
So gut es geht, schütze ich das kostbare Streicholz gegen die Zugluft vom Logenbalkon. Trotzdem flackert die Flamme gefährlich.
Bitte nicht, bitte! Als ich die Flamme an der ersten Kerze habe, weht sie aus. Ein kleines Wölkchen Rauch. Bloß der obere Docht ist leicht schwarz.
Noch eine Minute höchstens. Keine Zeit, andere Lösungen zu suchen.
Das letzte Streichholz ist meine letzte Chance. Beinahe balle ich eine Faust um die Flamme: Um nichts in der Welt will ich sie der Zugluft aussetzen.
Nach elf Kerzen ist das Streichholz fast heruntergebrannt. Ich beiße mir auf meine Zunge, denke am Schmerz vorbei so gut es eben geht.
Millimiter ist die Flamme entfernt von meinen Fingerspitzen, als ich auf der Tarte das Feuerwerk entzünde. Dann brennt sie sich in mein Fleisch, dass mir Tränen in die Augen schießen.
Noch eine Zündschnur! Zeigefinger und Schnur verschmelzen im Feuer. Ich gebe keinen Mucks von mir.
Glücklich verhindere ich es, dass die Asche des herunter gebrannten Streichholzes auf die Tarte fällt. Dann werfe ich meine Hände samt Asche in kalt gewordenes Spülwasser. Zum Stolz sein bleiben mir bloß Sekunden.
Als die Jüngste hineinfegt, meine Frist auf Erden zu beenden, rolle ich ihr bereits entgegen mit dem Servierwagen.
Ihr Mund verzerrt sich: Mist!
Offenbar hat Tiger noch keinen Blick gehabt für den Balkon der jungen Herrinnen. Unerwiederte Liebe macht blutrünstig.
„Mylady gab mir fünf Minuten“, knickse ich. Kopf nach unten, mag passieren was will.
Die Jüngste wirft Morgaines Lathi auf eines der Lammfelle vor dem Balkon. Als wäre das Schlagholz verbotenes Spielzeug, bei dem sie ertappt worden ist.
„Erdbeeren!“ jubeln mehrere Herrinnen vom Balkon. Morgaine wendet sich nicht um und tut keinen Schritt.
„Mylady?“
„Schneide schon an! Oder hast Du das nicht gelernt auf der Elefantenschule?“
Morgaine wirkt, als wäre sie „in Love“. Als wollen sie jeden Milimeter Leben von Tiger Larsen hören, sehen, fühlen. Ein Schauer läuft mir durch die Brust, so stark empfinde ich mit ihr.
„Das hat die Elefantenfrau Dir doch geklaut!“
Erschrocken blicke ich auf. Sofort schaue ich wieder auf meine Arbeit, die Tarte in kerzengerade Stücke zu schneiden. Gesehen habe ich allerdings, dass die Jüngste mir auf den Hals gezeigt hat.
Mein Medaillon, es ist mir aus der Uniform gerutscht!
Unbeirrt schneide ich weiter. Selbst als die Herrinnen um mich ins Tuscheln kommen.
Erst als ich Morgaines Schuhe neben mir sehe, halte ich inne.
„Elefantenfrau!“
„Mylady?“
„Schau mal an die Decke.“
Ich tue wie mir geheißen. Mein Hals liegt frei.
Als Morgaine mir an mein Medaillon will, zucke ich zurück.
„Was fällt Dir ein?“ erschreckt Morgaine über meinen Ungehorsam.
„Schlag sie!“ wütet die Jüngste.
„Gib mir das Dings um Deinen Hals, nimm es ab!“
„Katzengold“, höre ich eine Herrin kichern.
Ich schüttele den Kopf. Fest blicke ich dabei zu Boden. So dass mein Medaillon eingeklemmt ist zwischen Kinn und Hals.
Morgaine reißt mir den Kopf hoch, stößt mich zurück. Hinter mir der Tisch. Weiter weg kann ich nicht.
„Gibs mir!“ Morgaines Hand gleicht einer Klaue.
Ich schlucke, halte dabei aber eisern fest an jeder Träne. Gerne hätte ich Mutter jetzt an meiner Seite. Als sie noch jung war, und wegen mir mit den Ämtern stritt.
Schon ist die Jüngste hinter mir. Zwei weitere Herrinnen halten mir gleichgültig die Arme fest. Ich wehre mich nicht. Trotzdem werfen sie micht zu viert auf den Boden. Kurz spüre ich noch mein Medailllon, dann ist es fort.
Morgaine präsentiert mit spitzen Fingern die Beute.
Pflichtbewusste Lacher. Niemand will als Spaßbremse dastehen.
„Hast Du mir das gestohlen?“
Mit gespielter Neugier lässt Morgaine mein Medaillon vor mir pendeln. Während die Jüngste mich am Uniformkragen festhält, dass ich schwer Luft bekomme.
„Mylady...“
„Mylady, Malady“, höhnt Morgaine. „Elefantenfrauen dürfen nichts aus Gold besitzen, weißt Du das nicht?“
Sie blickt kritisch auf mein Medaillon, tickt einmal dagegen, verzieht das Gesicht. Als würde mein Medaillon stinken.
„Nein, mir hat sie das Dings nicht gestohlen. Euch vielleicht?“
Einige Herrinnen winken ab. Die meisten essen bereits mit Appetit von der Erdbeertarte. Zeit, dem Spaß ein Ende zu machen.
„Gestohlen hat sie es aber gewiss jemanden!“
Morgaine stolziert zum Balkon. Dabei schwingt sie mein Medaillon wie ein Lasso.
Ich reiße mich los.
Dafür gibt die Jüngste mir einen Tritt: „Friss Staub!“
Auf allen Vieren folge ich Morgaine.
Die steht auf dem Balkon, während ihr schlemmendes Publikum hinter dem Panoramafenster zurück bleibt.
„Überantworten wir das Diebesgut der Allgemeinheit“, lacht sie hinein in die Musik der Gottesfurcht.
Ich krabbele so schnell ich kann. Aber Morgaine hält mich mit Tritten auf Distanz. Sie schwingt mein Medaillon jetzt über der Balkonbrüstung:
„Möge es seinen rechtmäßigen Besitzer wiederfinden“, grinst sie mit gespielter Feierlichkeit.
„Mylady, ich flehe sie an!“
„Kraftur hafsins – Macht des Meers!“ donnert es durch die Arena.
Tiger singt deutsch! Etwas anderes denke ich nicht, als die Jüngste mir von hinten meine Füße wegreißt.
Ich platsche der Länge nach auf den Boden des Balkons. Morgaine weicht vor mir zurück wie vor einem Haufen Fleischabfall. Mein Medaillon hängt vergessen in ihrer Hand.
„Kraftur hafsins – Macht des Meers!“
Zum Chorus rasen Scheinwerfer über die Balkons der Logen. Mein Medaillon erstrahlt im Licht, als wäre es ein Sonnenaufgang.
Morgaine schreit auf. Geblendet taumelt sie zurück.
Das Medaillon fällt.
Ich sehe meine Hand kaum, so schnell greife ich danach. Ich berge es vor meiner Brust, rutsche damit bis an den äußersten Rand des Balkons.
„Ich sehe nichts mehr!“ Morgaine presst ihre Augen zusammen, öffnet sie, presst sie wieder zusammen.
Verwirrt suche ich die Scheinwerfer, was für ein Licht um Himmels willen derart explodieren konnte?
Stattdessen finde ich ihn. Von dem gewaltigen Videowürfel an der Decke der Arena blickt er auf mich hinab. Tiger Larsen. Sein Mund leicht geöffnet, die Halsmuskeln gespannt. Einen Ton zu halten, der dem Singen eines Schwertes gleicht.
Seine Stimme trägt die Halle. Sie hebt Tausende aus ihren Sitzen, als wären es Püppchen.
Wann habe ich das letzte Mal in mir solch eine Lust am Leben gespürt?
Unsere Augen treffen sich.
Lindgrün sind die seinen. Das Licht hunderter Scheinwerfer spiegelt sich in ihnen. Nein, es flutet hinein! Als könnten diese Augen allen Glanz der Welt aufnehmen…
„Elefantenfrau!“ Morgaine fixiert mich. Wild. Brutal.
Die Münder der Herrinnen hinter dem Panoramafenster sind bloß erschrockene Os.
„Verschwinde. Sofort.“
„Verzeihen Sie, Mylady!“
Ich halte mein Medaillon in der Faust, als ich vom Balkon flüchte,
„Lauf Elefantenfrau“, grinst die Jüngste mit vollem Mund. „Lauf so schnell Du kannst!“
chSchlesinger - 8. Mai, 15:27